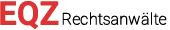Verwalter darf (Hausmeister-)Arbeitsvertrag kündigen
22. Mai 2025Verspätete Zielvorgabe führt zu vollem Schadensersatz
3. Juli 2025Der BGH entschied, dass § 577 Abs. 1 Satz 1 BGB – der dem Mieter ein Vorkaufsrecht zusichert, wenn Wohnraum in Wohnungseigentum umgewandelt und verkauft wird – analog auch greift, wenn Teileigentum (zur Wohnnutzung) begründet wird. Eine solche Analogie ist zur Schließung einer planwidrigen Gesetzeslücke notwendig. Sie folgt dem gleichen Schutzzweck: Mieterschutz bei Umwandlung und Verhinderung möglicher Eigenbedarfskündigungen.
Sachverhalt: Ein Mieter (Kläger) bewohnte seit 2006 eine Mietwohnung. 2017 wurde vonseiten des Vermieters (als Testamentsvollstrecker) Teileigentum mit Wohnzweck an dieser Einheit begründet und diese gemeinsam mit weiteren Einheiten verkauft. Der Kläger wurde schriftlich über sein gesetzliches Mietvorkaufsrecht informiert – u.a. mit Hinweis auf eine zweimonatige Frist zur Ausübung. Diese Frist verstrich jedoch im März 2018 (erst im August 2019 erklärte er seinen Wunsch, von dem Recht Gebrauch zu machen). Inzwischen hatte die Käuferin die Wohneinheit weiterverkauft. Der Mieter beanspruchte daraufhin Schadensersatz wegen der Fristversäumnis.
Der BGH entschied weiter, dass die Frist des § 577 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 469 Abs. 2 Satz 1 BGB eine Ausschlussfrist ist, die nach ihrem Ablauf nicht mehr der Disposition der Parteien unterliegt (Fortführung von Senatsurteil vom 02.12.1970 – VIII ZR 77/69, BGHZ 55, 71, 75 [noch zur inhaltsgleichen Vorgängervorschrift des § 510 Abs. 2 BGB a.F.]).)